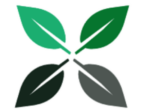Die dezentrale Löschwasserversorgung rückt immer stärker in den Fokus – besonders in ländlichen Regionen oder am Rand von Wohngebieten. Hydranten sind dort oft Mangelware oder gar nicht vorhanden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Grundstückseigentümer, sich aktiv mit dem Brandschutz auf dem eigenen Gelände zu befassen. Besonders bei größeren Grundstücken, Nebengebäuden oder Anlagen mit Brandlasten (z. B. Photovoltaikanlagen, Holzlager, Stallungen) ist eine entsprechende Vorsorge essenziell. In diesem Beitrag klären wir, welche rechtlichen Vorgaben gelten, welche technischen Lösungen möglich sind und wie Eigentümer praxisnah vorsorgen können.
Gesetzliche Grundlagen und kommunale Anforderungen
In Deutschland ist der Brandschutz zweigeteilt geregelt: auf Landesebene und durch kommunale Satzungen. Die Feuerwehrgesetze der Länder definieren in der Regel nur allgemeine Pflichten. Die Details zur Löschwasserversorgung, insbesondere in abgelegenen Gebieten, regeln Gemeinden oft selbst – per Brandschutzbedarfsplan oder Sonderregelungen für Neubaugebiete.
Wichtig für private Grundstückseigentümer:
-
Gemeinden können per Bauordnung oder Baugenehmigung Auflagen zur Löschwasservorhaltung machen.
-
In vielen Bundesländern (z. B. Bayern, Niedersachsen) wird bei fehlender Anbindung an das Hydrantennetz ein Löschwassertank vorgeschrieben.
-
Die Verantwortung für die Bereitstellung liegt dann teils beim Eigentümer – insbesondere bei Sonderbauten, Reiterhöfen, Veranstaltungsflächen oder abgelegenen Wohnhäusern.
Die einschlägige Norm, an der sich viele Planungen orientieren, ist die DIN 14210 („Löschwasserbehälter – Grundsätze, Anforderungen, Prüfung“).
Welche Löschwasserlösungen auf privatem Grund möglich sind
Je nach Grundstücksgröße, Lage und Risiko können unterschiedliche Lösungen infrage kommen. Folgende Optionen gelten als praxisbewährt:
| Variante | Beschreibung |
|---|---|
| Löschwassertank | Unterirdisch oder oberirdisch installierte Tanks aus Kunststoff oder Beton, meist 5.000 bis 100.000 Liter. |
| Zisterne mit Löschfunktion | Doppelnutzung von Regenwassernutzung und Löschwasserbevorratung – nur zulässig mit freiem Auslauf und abgetrenntem Volumen. |
| Löschteich oder offenes Gewässer | Nur genehmigungsfähig, wenn ganzjährig Wasser vorhanden ist und ein klarer Zugang für Feuerwehrfahrzeuge gegeben ist. |
| Wasserentnahmestelle an Gewässern | Möglich bei landwirtschaftlichen Flächen, aber genehmigungspflichtig (Wasserrecht beachten). |
Die beste Lösung hängt vom Brandschutzkonzept, der topografischen Lage und dem Einsatzziel der Feuerwehr ab.

Anforderungen an Zugänglichkeit und Entnahmestellen
Löschwassertanks allein reichen nicht aus – er muss im Ernstfall erreichbar und nutzbar sein. Folgende Punkte sind dabei zwingend zu beachten:
-
Zufahrt: Feuerwehrfahrzeuge müssen bis auf max. 3 m an die Entnahmestelle heranfahren können.
-
Entnahmeeinrichtung: In der Regel wird ein Storz-A-Kupplungsanschluss nach DIN verlangt.
-
Kennzeichnung: Der Standort muss beschildert und dokumentiert sein – idealerweise auch im Einsatzleitrechner der Feuerwehr eingetragen.
-
Wartung: Tanks müssen regelmäßig geprüft und ggf. gespült werden. Viele Gemeinden verlangen entsprechende Nachweise.
Kosten und Fördermöglichkeiten
Die Anschaffungskosten für eine dezentrale Löschwasservorhaltung variieren stark – abhängig von Bauweise, Größe und Einbindung in ein Gesamtsystem:
| Kostenpunkt | Preisspanne (brutto) |
|---|---|
| Kunststofftank (10.000 Liter) | 3.000–6.000 € |
| Betontank (unterirdisch, 50.000 Liter) | 12.000–25.000 € |
| Kombinierte Zisterne/Löschwasser | ab 5.000 € |
| Wartung und Prüfung pro Jahr | 150–400 € |
Tipp: In manchen Bundesländern oder Gemeinden gibt es Zuschüsse oder Steuererleichterungen für Maßnahmen zur privaten Gefahrenabwehr – insbesondere bei Landwirtschaftsbetrieben oder im Rahmen des Katastrophenschutzes. Hier lohnt ein Gespräch mit dem zuständigen Bauamt oder der örtlichen Feuerwehr.
Vorteile einer privaten Löschwasservorhaltung
-
Erhöhte Sicherheit bei abgelegenen oder gefährdeten Objekten
-
Bessere Versicherbarkeit von Gebäuden in Risikolagen
-
Gutes Verhältnis zur Feuerwehr, da diese im Ernstfall effektiver handeln kann
-
Eigenverantwortung zeigen – gerade in Zeiten steigender Extremwetterlagen und Waldbrandrisiken
Was Eigentümer jetzt tun sollten
Wer auf einem größeren Grundstück lebt oder in einem Bereich ohne Hydrantenversorgung baut, sollte frühzeitig Kontakt mit der örtlichen Feuerwehr aufnehmen. In vielen Gemeinden gibt es individuelle Beratungstermine, in denen geklärt wird, ob ein Löschwassertank nötig ist, welche Größe sinnvoll ist und wie die Einbindung erfolgen kann. Ein technisches Brandschutzkonzept hilft dabei, auch genehmigungsrechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Quiz: Wie gut bist du auf einen Brandfall vorbereitet?
Teste in 2 Minuten, ob dein Grundstück im Ernstfall ausreichend gesichert ist.
1. Gibt es auf deinem Grundstück oder in direkter Nähe eine Löschwasserentnahmestelle (z. B. Hydrant, Zisterne, Teich)?
☐ Ja
☐ Nein
☐ Weiß ich nicht
2. Weißt du, welche Anforderungen deine Gemeinde an die Löschwasservorhaltung stellt?
☐ Ja, ich habe mich informiert
☐ Nein, noch nie damit befasst
☐ Ich bin mir unsicher
3. Ist dein Grundstück für große Feuerwehrfahrzeuge problemlos erreichbar?
☐ Ja, Zufahrt ist jederzeit frei und tragfähig
☐ Eingeschränkt, z. B. bei Schnee oder geparkten Autos
☐ Nein oder weiß ich nicht
4. Gibt es einen festen Ansprechpartner bei der Feuerwehr oder im Bauamt, der für dein Gebiet zuständig ist?
☐ Ja
☐ Nein
☐ Keine Ahnung
5. Kennst du die jährlichen Wartungspflichten für Löschwassertanks?
☐ Ja, ich führe oder plane sie durch
☐ Ich wusste nicht, dass es welche gibt
☐ Ich überlasse das jemand anderem
💡 Auswertung:
-
4–5 x „Ja“: Du bist sehr gut vorbereitet.
-
2–3 x „Ja“: Es gibt noch Lücken – hol dir eine Beratung bei der Feuerwehr.
-
0–1 x „Ja“: Höchste Zeit zu handeln. Ein Löschwassertank oder eine andere Vorsorgelösung sollte dringend geprüft werden.
Verantwortung beginnt auf dem eigenen Grundstück
Die zentrale Wasserversorgung endet nicht selten dort, wo private Verantwortung beginnt. Wer heute baut oder lebt, wo Hydranten fehlen, trägt eine besondere Pflicht – sich selbst, seinen Nachbarn und der Umwelt gegenüber. Eine funktionierende dezentrale Löschwasservorhaltung ist keine Kür. Sie ist die logische Konsequenz aus Lage, Risiko und Realität. Wer handelt, schützt. Wer plant, gewinnt wertvolle Zeit im Ernstfall.
Bildnachweis: thauwald-pictures, Eakrin, MuhamadNoorHazwan / Adobe Stock